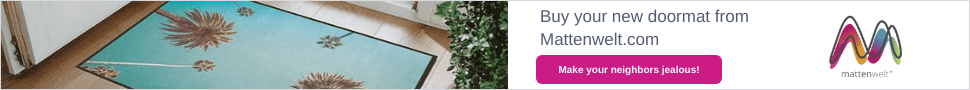Landesverband fordert zum Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende mehr Sensibilität
Wilhelmshaven / Hannover – Anlässlich eines Todesfalls in Wilhelmshaven mahnt der Landesverband Sexuelle Gesundheit Niedersachsen (LSGN) zum Drogentotengedenktag am 21. Juli mehr Menschlichkeit im Umgang mit Drogengebrauchenden an.
„Aktuell untersuchen wir, wie es zum Tod des Mannes kommen konnte, obwohl er sich kurz zuvor zwei Mal hilfesuchend an den Rettungsdienst und an eine Arztpraxis gewandt hatte“, sagt Christin Engelbrecht, Geschäftsführerin des LSGN. „Sollte sich herausstellen, dass die Verantwortlichen die Not des Mannes ignorierten, ist das ein Skandal und unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge.“
Laut LSGN steht der Fall exemplarisch für eine systemische Schwäche: Viele Drogengebrauchende scheuen sich, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen – aus Scham, Angst oder wegen schlechter Erfahrungen. Im Fall von Wilhelmshaven sei das Gegenteil der Fall gewesen. Der Betroffene habe aktiv und mehrfach Hilfe gesucht, sei jedoch abgewiesen worden. Zwei Tage später verstarb er an den Folgen einer vermuteten Sepsis, die durch verunreinigtes Kokain ausgelöst worden sein könnte.
„Dieser Mensch hat alles richtig gemacht – und ist dennoch gestorben“, so Engelbrecht. „Das ist nicht nur inakzeptabel, das ist unmenschlich.“
Die Aidshilfe Wilhelmshaven, die den Mann kannte, fordert seit Langem eine bessere Schulung medizinischen Personals im Umgang mit drogenabhängigen Menschen – insbesondere im ländlichen Raum. Die Angst vor Diskriminierung oder Vorverurteilung sei nach wie vor groß.
Aktuell warnt auch die Deutsche Aidshilfe vor einem wachsenden Risiko durch synthetische Opioide wie Fentanyl und Nitazene. Diese Substanzen sind billig herzustellen, leicht zu schmuggeln und wirken sehr stark. Eine Überdosierung kann schnell tödlich verlaufen – selbst bei erfahrenen Konsumierenden.
„Gerade vor diesem Hintergrund darf der Gedenktag am 21. Juli keine leere Geste bleiben“, betont Engelbrecht. „Wir brauchen mehr Bewusstsein für die Probleme suchtkranker Menschen, mehr Aufklärungsarbeit – und vor allem mehr Mitgefühl und Einsatz in Notsituationen.“