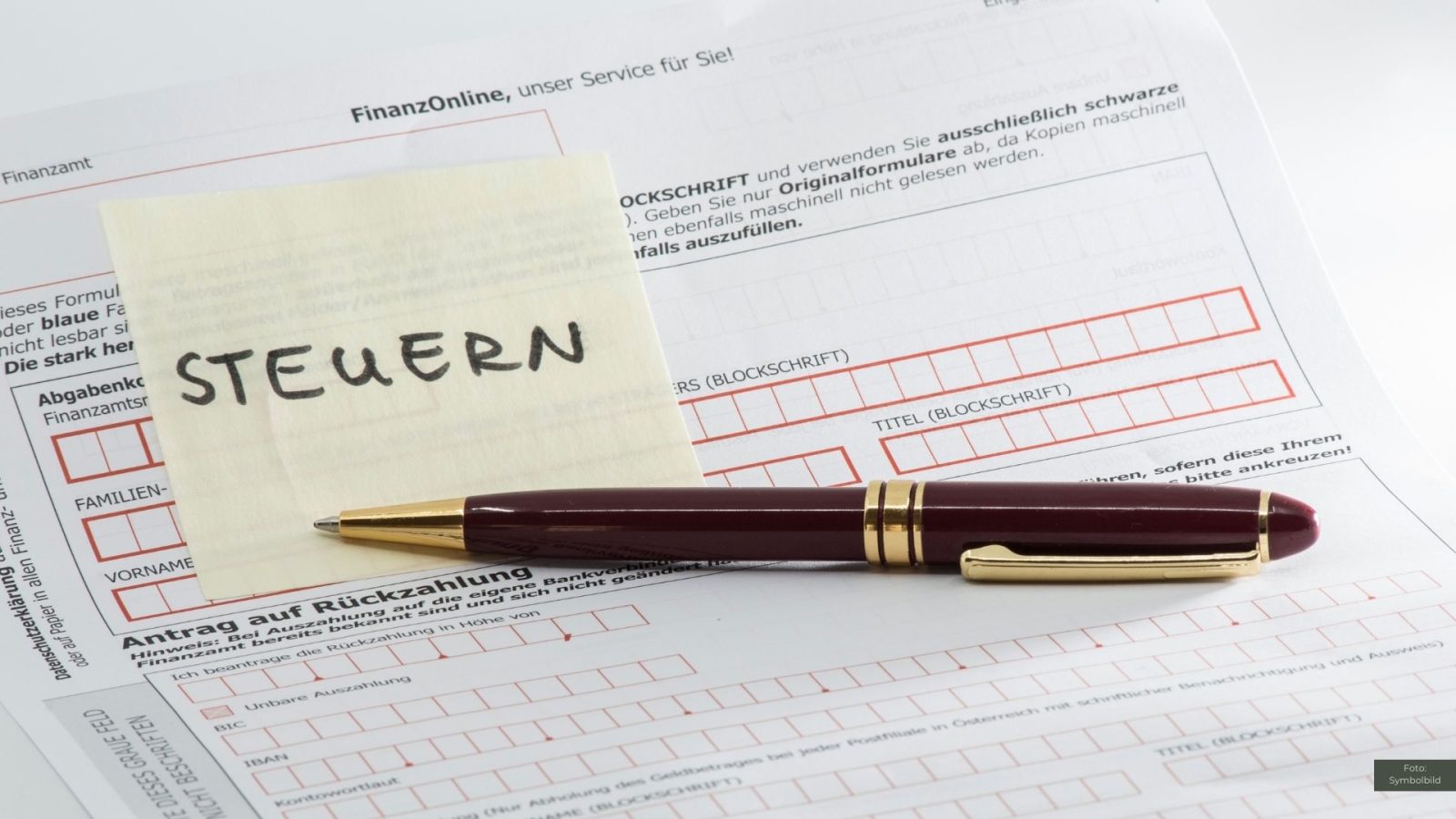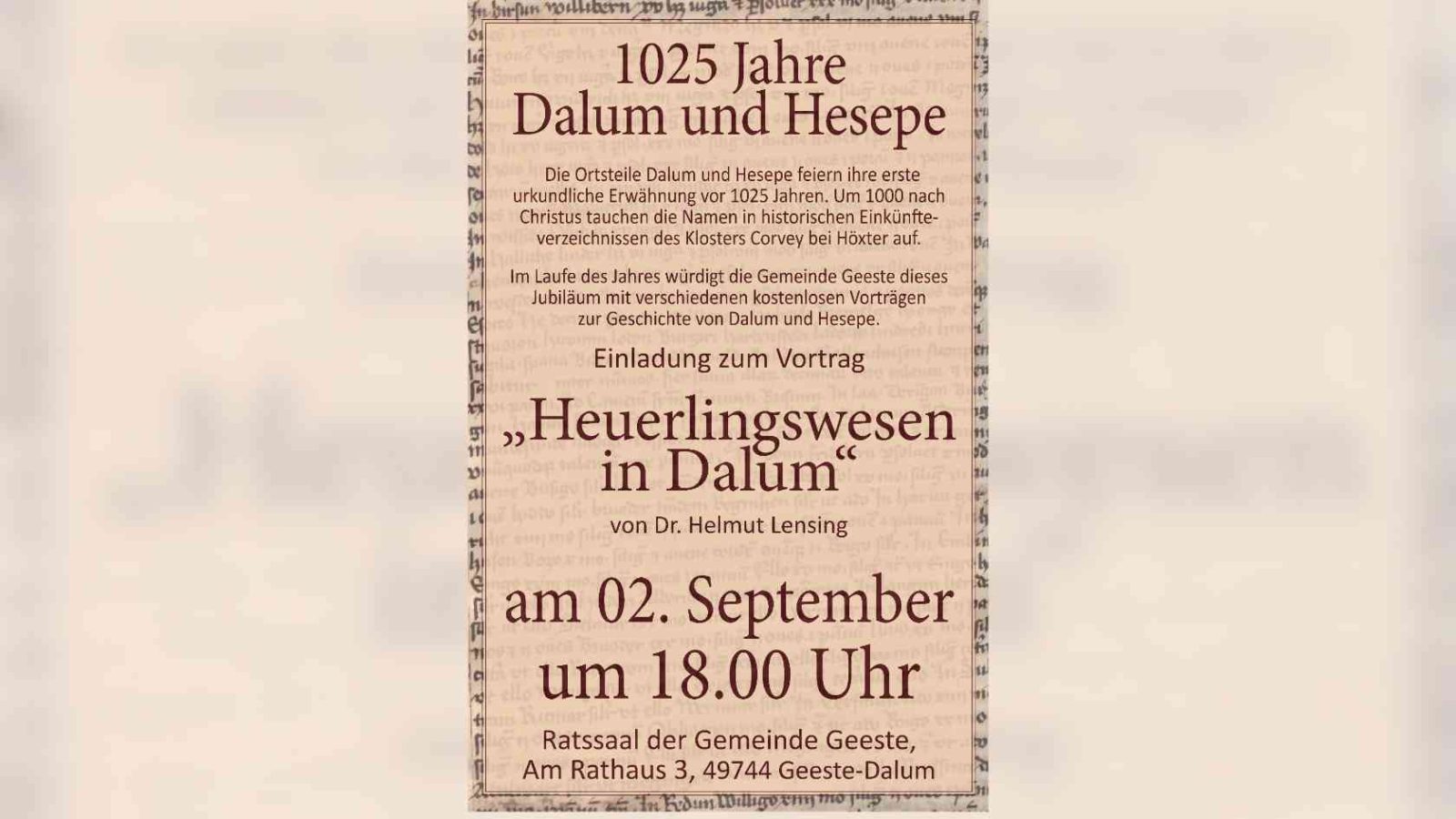Grafschaft Bentheim. Fünf Menschen, fünf Lebenswege – und ein gemeinsamer Ort: die Grafschaft. In der Dokumentation „Eine verhinderte Grafschaft Bentheim“ aus dem Jahr 1985 erzählen Zeitzeugen, was ihre Heimat ausmacht. Ihre Geschichten sind verschieden, aber sie zeigen, wie stark persönliche Erfahrungen mit dem regionalen Selbstverständnis verwoben sind. Wir stellen fünf von ihnen vor.
Friedrich Hartmann – Der Maler in der Windmühle
Nach dem Krieg kam Friedrich Hartmann aus dem Rheinland nach Gildehaus. Der Hunger trieb ihn in die Grafschaft, die er mit seiner Kunst gegen Brot erkundete. In einer alten Windmühle fand er schließlich nicht nur ein Atelier, sondern auch Heimat. Obwohl er anfangs skeptisch beäugt wurde, ist er längst Teil der Gemeinschaft. Heute wird er sogar um Rat gefragt, wenn es um die kulturelle Entwicklung der Region geht.
Eines seiner bekanntesten Werke, „Der leere Stuhl“, hängt in der Alten Reformierten Kirche in Nordhorn. Es steht sinnbildlich für die Stimmung vieler seiner Bilder: zurückhaltend, nachdenklich, voller innerer Tiefe. Hartmanns Kunst ist fest mit der Landschaft und den Menschen der Grafschaft verbunden – ein Spiegel einer Region, die geprägt ist von Geschichte und Gemeinschaft.
Heinrich Funke – Der Schuhmacher und Chronist
In einer kleinen Werkstatt in Schüttorf repariert Heinrich Funke Schuhe – mit Maschinen aus einer anderen Zeit. Doch der Schuhmacher ist nicht nur Handwerker, sondern auch Hüter der Geschichte. Als Ortschronist kennt er die Vergangenheit der Obergrafschaft wie kaum ein anderer. Er erinnert an Zeiten des Reichtums durch den Bentheimer Sandstein – und an den wirtschaftlichen Einbruch infolge kriegerischer Zerstörung.
Für Funke ist klar: Die Grafschaft war einmal wohlhabend, wurde dann durch politische Umbrüche gebeutelt und kämpfte sich wieder hoch. Trotz ihrer Größe sei sie in vielem eigenständig geblieben – und das zu Recht. Auch im Zeitalter der Rationalisierung hält er an Werten wie Tradition, Eigenständigkeit und Handarbeit fest.
Wilhelm Schrader – Der Drogenberater aus Überzeugung
Wilhelm Schrader kennt die Schattenseiten der Jugend in der Grafschaft. Seit 1972 engagiert er sich als Drogenberater in Nordhorn. Was ihn antreibt, ist mehr als Beruf – es ist eine Berufung. Schrader sieht seine Arbeit als christlichen Auftrag, er will Jugendlichen eine Perspektive geben, bevor sie „in der Gosse landen“, wie er es ausdrückt. Mit 70 Wochenstunden, oft unter Bedrohung durch Dealer, ist er Tag für Tag im Einsatz.
Die Drogenproblematik sei massiv, sagt er. Die Nähe zur niederländischen Grenze mache die Region zu einem Knotenpunkt im europäischen Drogenhandel. Umso wichtiger seien Jugendzentren, offene Gespräche und ein funktionierendes Netzwerk. Schrader bleibt dabei kompromisslos: Er kämpft für jeden Einzelnen – gegen Abhängigkeit, für Hoffnung.
Jan Meppelink – Der Naturfreund mit niederländischen Wurzeln
Jan Meppelink aus Neuenhaus ist ein Original. Nach seiner Pensionierung bei der Bentheimer Eisenbahn wurde er Bisamfänger – eher zufällig, aber mit Hingabe. Für jedes Tier erhält er eine Prämie, doch der eigentliche Antrieb ist seine Liebe zur Natur. Meppelink kennt die Grafschaft wie seine Westentasche. Seine niederländischen Wurzeln sind dabei ebenso Teil seiner Identität wie seine Verbundenheit zur Region.
Sein Alltag führt ihn durch Moore und an Flussläufen entlang. Mit Stolz erzählt er von den Traditionen seiner Familie und davon, wie sich die Grafschafter über die Jahre behauptet haben – fleißig, bodenständig, eigenwillig. Dass er sich selbst als echten Grafschafter sieht, daran lässt Meppelink keinen Zweifel.
Anton Groeneveld – Der holländische Nachbar
Direkt hinter der Grenze bei Emlichheim lebt Anton Groeneveld. Der Landwirt bewirtschaftet seine Flächen mit einer Effizienz, die man oft mit holländischer Landwirtschaft verbindet. Für ihn zählt, was wirtschaftlich funktioniert – ganz im Gegensatz zur stärker subventionierten und zentralisierten Agrarstruktur in Deutschland.
Trotz aller Unterschiede verbindet ihn viel mit seinen deutschen Nachbarn: die Landschaft, das Wetter, das Leben auf dem Land. Und die gegenseitige Wertschätzung. Während in Deutschland häufig noch in größeren Strukturen gedacht werde, habe sich in Holland eine pragmatischere Haltung durchgesetzt. Für Groeneveld ist klar: Das eine schließt das andere nicht aus – sondern ergänzt sich oft.