In einer Zeit des ständigen Wandels stehen Unternehmen vor der Herausforderung, nicht nur effizient, sondern auch anpassungsfähig und menschlich zu bleiben. Ralf Haase, ein Experte für systemische Organisationsentwicklung und Leiter der Personalabteilung bei der AIOS Tax AG Steuerberatungsgesellschaft in Berlin, blickt hinter die Kulissen des Arbeitsalltags. Im Gespräch mit regionalupdate.de teilt er seine tiefen Einsichten, wie das Verständnis von Systemen Unternehmen, insbesondere im ländlichen Raum, zu mehr Wirksamkeit verhelfen kann.
Der Moment, der alles veränderte: Begegnung mit der Systemtheorie
Ralf Haase erinnert sich genau an den Moment, als ihm die Systemtheorie zum ersten Mal begegnete, auch wenn er sie damals noch nicht so nannte. „Es war in einem Präsenzseminar in Köln. Lars Vollmer stand auf der Bühne und sagte sinngemäß: ‚Ich will nicht mehr gefallen. Ich will Wirksamkeit entfalten. Und dafür muss ich manchmal den Finger in die Wunde legen.‘“ Das war anders als alles, was er bis dahin von Vorträgen kannte – keine Heldenreisen, keine Führungsfloskeln, sondern jemand, der Strukturen in Frage stellte, statt Menschen zu beschuldigen.
Dieser Vortrag war der Beginn einer tiefen Auseinandersetzung. Bei Intrinsify fand er Worte für Fragen, die ihn schon lange umtrieben hatten: Warum scheitern gut gemeinte Veränderungen an unsichtbaren Regeln? Wieso tun sich Organisationen oft schwerer mit Erfolg als mit Mangel? Und warum reicht es nicht, an Menschen zu arbeiten, wenn man etwas verändern will? „Die Systemtheorie hat mir keine einfachen Antworten geliefert, aber sie hat mir erlaubt, klüger zu fragen. Nicht linear, sondern zirkulär. Nicht moralisch, sondern beobachtend“, so Haase. Für ihn ist sie kein Denkmodell, sondern ein Beobachtungsinstrument, das hilft, Widersprüche sichtbar zu machen, ohne sie vorschnell aufzulösen. Das brauche es heute: Weniger Steuerungsversuche, mehr Verständnis für das, was sich strukturell gegen Veränderung wehrt – oft ganz ohne böse Absicht.
Strukturen, die ermöglichen: Was wirklich funktioniert
Ralf Haase hat klassische Hierarchien erlebt – als Projektleiter, Niederlassungsleiter, später als interner Berater. Sie bieten Sicherheit und versprechen Klarheit, haben aber ihren Preis: „Sie filtern Kommunikation, sie erzeugen Angst vor Fehlern, und sie machen Veränderung oft zur Chefsache – mit allen bekannten Nebenwirkungen.“
Die neuen Wege, die er später initiierte, etwa in selbstorganisierten Recruiting-Teams oder in offenen Dialogformaten zur Kanzleientwicklung, waren für ihn keine Abkehr von Hierarchie, sondern eine andere Art, Verantwortung zu organisieren. „Nicht ‚flach‘, nicht ‚basisdemokratisch‘, sondern strukturell durchlässiger. Kommunikation durfte wieder zirkulieren, nicht nur rapportiert werden.“ Er lernte: Es braucht Struktur – aber nicht zur Kontrolle, sondern zur Ermöglichung. Es braucht Führung – aber nicht als Position, sondern als Funktion, die ständig neu verteilt wird. Und es braucht Klarheit – nicht über Zuständigkeiten, sondern über gemeinsame Suchbewegungen. „Was besser funktioniert hat, war nie das Modell, sondern die Passung zwischen Aufgabe, Kontext und kommunikativer Anschlussfähigkeit“, resümiert Haase. Genau diese Passung herzustellen, sei für ihn der Kern von Führung, unabhängig von Organigrammen.
Transformation im ländlichen Raum: Der Mut zum Blick auf blinde Flecken
Organisationen, gerade im ländlichen Raum, tun sich oft schwer mit echter Transformation. Haase erklärt den Unterschied: „Veränderung bedeutet, etwas Bekanntes zu optimieren. Transformation bedeutet, nicht zu wissen, was am Ende herauskommt und trotzdem loszugehen.“ Dies falle Organisationen schwer, deren Überlebenslogik auf Stabilität, Verlässlichkeit und Nähe beruhe.
Im ländlichen Raum gebe es oft starke Bindungen – zwischen Mitarbeitern, zu Kunden, in Netzwerke hinein. Das sei ein Schatz, aber auch ein Risiko. „Denn wo Nähe herrscht, dominiert schnell Loyalität statt Irritation. Und echte Transformation beginnt fast immer mit einem Bruch vertrauter Erwartungen.“ Viele ländliche Unternehmen seien über Jahre erfolgreich gewesen, oft mit Handschlagqualität und implizitem Wissen. Was fehle, sei nicht der Wille zur Veränderung, sondern ein funktionierender Beobachtungsapparat für Selbstverständlichkeiten. „Man weiß, wie man handelt – aber nicht mehr, warum es bisher funktioniert hat. Und deshalb erkennt man auch nicht, wann genau dieses Handeln zur Belastung wird.“ Transformation erfordert den Mut, auf blinde Flecken zu schauen, auf Routinen, die unbesprechbar geworden sind. „Ländliche Organisationen scheitern nicht an mangelnder Innovationskraft, sondern oft am fehlenden Dialog über das, was nicht mehr gesagt wird“, so Haase.
„New Work“: Mehr als nur Kicker-Tisch und Purpose-Plakat
Das größte Missverständnis bei „New Work“ sei, dass es etwas mit „nett“ zu tun hätte. „Weniger Kontrolle, mehr Selbstverwirklichung, Kicker-Tisch und Purpose-Plakat. Aber echte Neue Arbeit ist kein Wohlfühlprogramm – sie ist eine Antwort auf strukturelle Überforderung“, stellt Haase klar. Frithjof Bergmann, der den Begriff prägte, meinte Arbeit, die man wirklich, wirklich will, unter Bedingungen, in denen klassische Arbeitsverhältnisse zerbröseln. Diese Spannung sei heute aktueller denn je.
„New Work“ werde oft zum Etikett für alles, was modern klingt, doch dabei fehle die Analyse der Entscheidungsprämissen. „New Work bedeutet für mich nicht: ‚Mach, was du willst‘, sondern: ‚Lerne, mit Nichtwissen produktiv umzugehen.‘“ Es brauche Strukturen, die Widerspruch aushalten und Kommunikation ermöglichen – auch dort, wo es weh tut. Das sei selten bequem, aber der einzige Weg, wie Organisationen in einer komplexen Welt handlungsfähig bleiben, ohne sich selbst zu belügen.
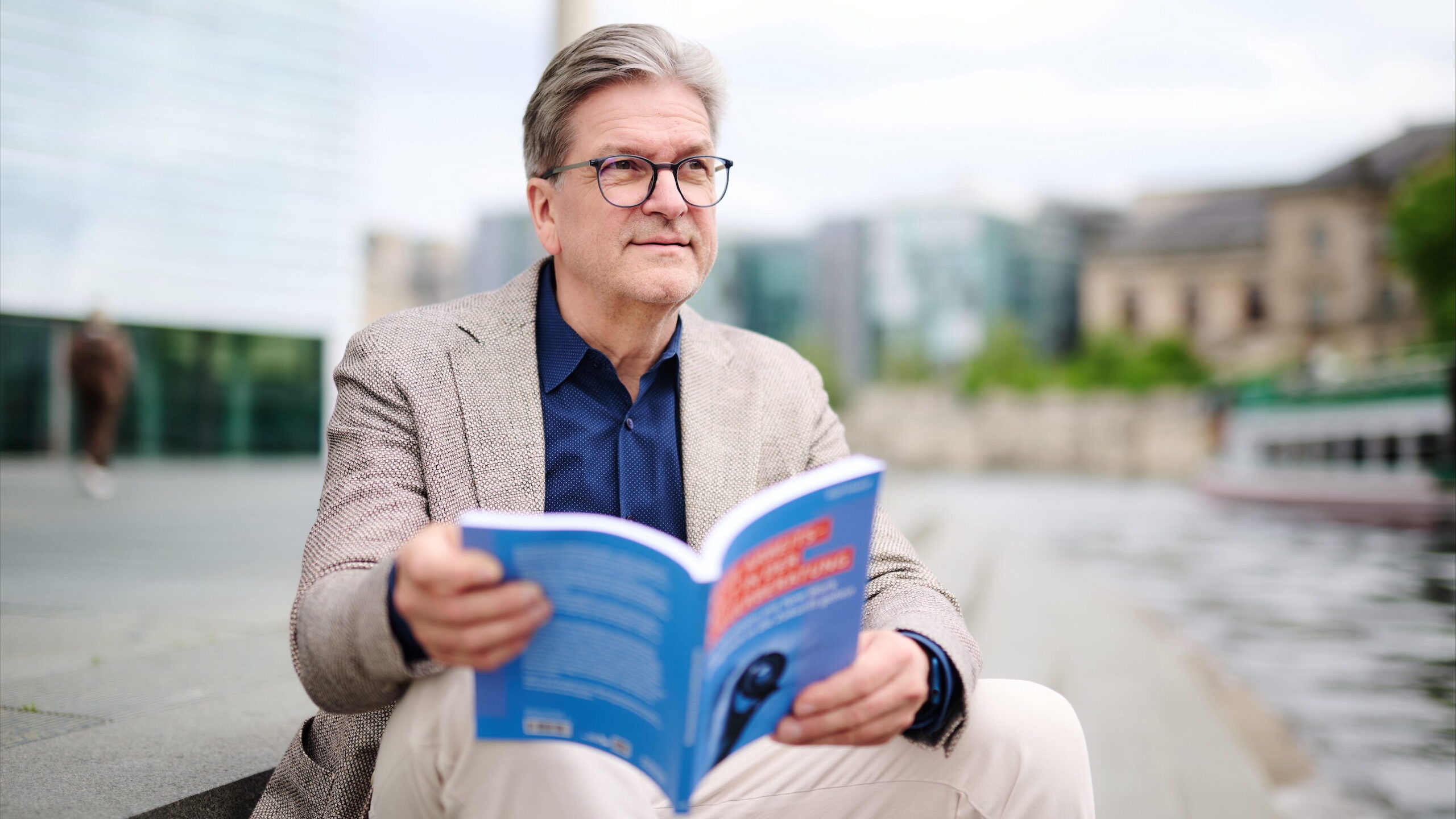
Werte und Kommunikation: Der Resonanzraum für das Unsichtbare
Werte und Kommunikation spielen in seiner Arbeit mit Führungsteams eine zentrale Rolle, jedoch anders, als viele denken. „Ich arbeite nicht an Werten, ich arbeite an Kommunikation über Werte“, sagt Haase. Denn in Organisationen zähle nicht das Plakat an der Wand, sondern das, was gesagt, verschwiegen oder sanktioniert wird, wenn es ernst wird. Werte seien in sozialen Systemen keine inneren Überzeugungen, sondern Beobachtungsformeln für Verhalten.
In Führungsteams schaut er deshalb auf Kommunikationsmuster, die Erwartungen erzeugen: Wer darf was sagen? Welche Spannungen dürfen offen benannt werden? Welche Konflikte werden ins Private verschoben, damit das System stabil bleibt? „Kommunikation ist der Ort, an dem Werte real werden oder scheitern. Und weil Organisationen aus nichts anderem bestehen als Kommunikation, beginnt jede Veränderung genau dort.“ Es gehe nicht um Wertedeklarationen, sondern um kommunikative Resonanzräume, in denen auch Unsicherheit, Ambivalenz und Widerspruch Ausdruck finden dürfen. Erst dann werden Werte wirksam – nicht als Norm, sondern als geteilte Beobachtung zweiter Ordnung.
Wenn das System sich selbst irritiert: Ein Beispiel aus der Praxis
Stolz ist nicht das erste Wort, das Ralf Haase einfällt, wenn er über Projekte spricht. Eher: „Es gibt Situationen, in denen ich gemerkt habe, dass mein Denken wirksam geworden ist – nicht weil ich Recht hatte, sondern weil etwas in Bewegung kam, das vorher festgefahren war.“
Ein Beispiel: In einer mittelständischen Steuerberatungskanzlei wurde er gebeten, das Recruiting zu verbessern. Schnell zeigte sich: Das Problem war nicht das Verfahren, sondern das System selbst. Es gab verdeckte Konflikte im Führungsteam, unklare Zuständigkeiten und eine tiefe Verunsicherung über das, was „gute Mitarbeiter“ überhaupt ausmacht. Statt eine Lösung zu liefern, stellte Haase Fragen – manchmal unbequeme. „Warum fällt es uns schwer, Entscheidungen transparent zu machen? Welche Bewerber lehnen wir ab, obwohl sie vielleicht genau das System in Bewegung bringen würden? Warum sagen wir, wir wollen Diversität – aber schreiben weiterhin Stellenanzeigen wie im Jahr 2005?“
Aus dem Recruiting-Projekt wurde ein Kulturprojekt. Nicht geplant, sondern weil sich die Kommunikation verschob. Führung wurde nicht netter, sondern klarer. Konflikte wurden nicht vermieden, sondern bearbeitbar gemacht. „Und plötzlich kamen Bewerbungen, die vorher nie eingegangen wären.“ Was er daran schätzt, sind nicht die „Ergebnisse“ im klassischen Sinn, sondern den Moment, in dem eine Organisation beginnt, sich selbst zu irritieren – nicht defensiv, sondern produktiv. „Das ist selten sichtbar, oft nicht messbar, aber genau dort beginnt echte Veränderung.“
Ein Impuls für Mittelständler: Das Unternehmen als System beobachten
Wenn er einem Mittelständler mit 30 Mitarbeitern einen einzigen Impuls geben dürfte, wäre das: „Hör auf, dein Unternehmen wie eine Familie zu behandeln und beginn, es als soziales System mit eigener Logik zu beobachten.“ Die Metapher von der „Unternehmensfamilie“ klinge warm, aber sie verschleiere, was wirklich wirkt: Machtverhältnisse, Entscheidungsstrukturen, blinde Flecken. Wenn alles auf Beziehungsebene verhandelt wird, blieben die strukturellen Probleme unsichtbar.
Sein Impuls wäre: „Bau dir ein Frühwarnsystem für Selbstverständlichkeiten.“ Beobachten, was als „normal“ gilt und nicht mehr hinterfragt wird. Wer spricht worüber? Was darf gesagt werden, ohne soziale Kosten? Welche Entscheidungen scheinen alternativlos – und warum? Nicht, um alles zu ändern, sondern um die Organisation wieder in die Lage zu versetzen, wirklich zu entscheiden. „Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber es erfordert eine Haltung: bereit zu sein, die eigenen Routinen in Frage zu stellen – ohne Schuldige zu suchen. Und das ist, ehrlich gesagt, selten. Aber genau deshalb wirksam.“
Die Zukunft von HR: Vom Dienstleister zum Seismographen
Die Rolle von HR in der Zukunft sieht Ralf Haase nicht als Entweder-Oder von Dienstleister oder Partner. „HR kann Dienstleister und Partner sein – aber beides greift zu kurz, wenn man nicht fragt: Wofür genau?“ In klassischen Organisationen wurde HR oft auf Verwaltung reduziert, später als „strategischer Partner“ aufgewertet. Doch das wirke oft hilflos, wenn die Strukturen blieben.
Er glaubt, dass HR in Zukunft vor allem systemische Anschlussfähigkeit braucht: „Nicht für die Menschen zuständig sein, sondern für die Rahmenbedingungen, unter denen Menschen arbeitsfähig werden. Nicht Feelgood-Verantwortung übernehmen, sondern Kontextverantwortung: Für die Qualität der Kommunikation, für die Beobachtung organisationaler Paradoxien, für die Irritationsfähigkeit des Systems.“ Wenn HR das schafft, sei es kein Dienstleister und kein Partner, sondern eine Art Seismograph. „Nicht beliebt, aber unersetzlich.“
Vertrauen in neue Strukturen: Verlernen, Rahmen schaffen, beobachten
Vertrauen in neue Strukturen ist kein Gefühl, das man beschließen kann, sondern das Resultat gelungener Anschlussfähigkeit unter veränderten Bedingungen. „Neue Strukturen brechen mit alten Erwartbarkeiten“, so Haase. Was hilft? Erstens: Verlernen als Kompetenz. Führungskräfte müssen alte Muster hinterfragen, besonders jene, die bisher erfolgreich waren. Zweitens: Rahmen, nicht Rezepte. Vertrauen wachse nicht im luftleeren Raum, sondern brauche Strukturen, die Orientierung geben, ohne alles vorzugeben. Klare Spielregeln, gute Fragen, regelmäßige Reflexionsschleifen und die Erlaubnis zu scheitern, ohne das System zu beschädigen. Drittens: Beobachtungswechsel. Statt nur das eigene Verhalten zu ändern, sollte das System beobachtet werden: Wo entstehen Reibungen? Welche impliziten Regeln gelten? „Vertrauen entsteht nicht durch Appelle. Es entsteht durch Erfahrungen, in denen Menschen merken: Diese Struktur trägt mich – auch wenn ich sie noch nicht vollständig verstehe.“
Der Blick hinter das Sichtbare: Eine Frage an sich selbst
Welche Frage würde sich Ralf Haase selbst stellen? „Was übersehen wir, wenn wir immer nur auf das schauen, was sichtbar ist?“ Seine Antwort: „Wir übersehen das Eigentliche. Denn Organisationen bestehen nicht aus dem, was sie tun – sondern aus dem, was sie nicht tun.“ Die größte Herausforderung der Führung heute sei nicht Überlastung, sondern Unterscheidung: Was gehört zur Organisation und was ist nur laut? Was muss ich entscheiden und was entscheidet sich ohnehin? Was klingt vernünftig und was ist tatsächlich wirksam?
„Ich glaube, wir brauchen mehr Führungskräfte, die nicht nach vorne preschen, sondern den Raum öffnen für das, was sich zeigen will. Die den Mut haben, nicht sofort zu handeln. Die beobachten, bevor sie eingreifen. Die Fragen stellen, bevor sie Antworten verkünden.“ Wenn er sich selbst etwas vornimmt, dann das: „Nicht klüger scheinen, sondern komplexitätsfähig bleiben. Und das heißt auch, aushalten zu können, dass manches offen bleibt – aber nicht unentschieden.“
Weitere Informationen über die Arbeit von Ralf Haase finden Sie auf seiner Website: www.neuearbeit.org.


