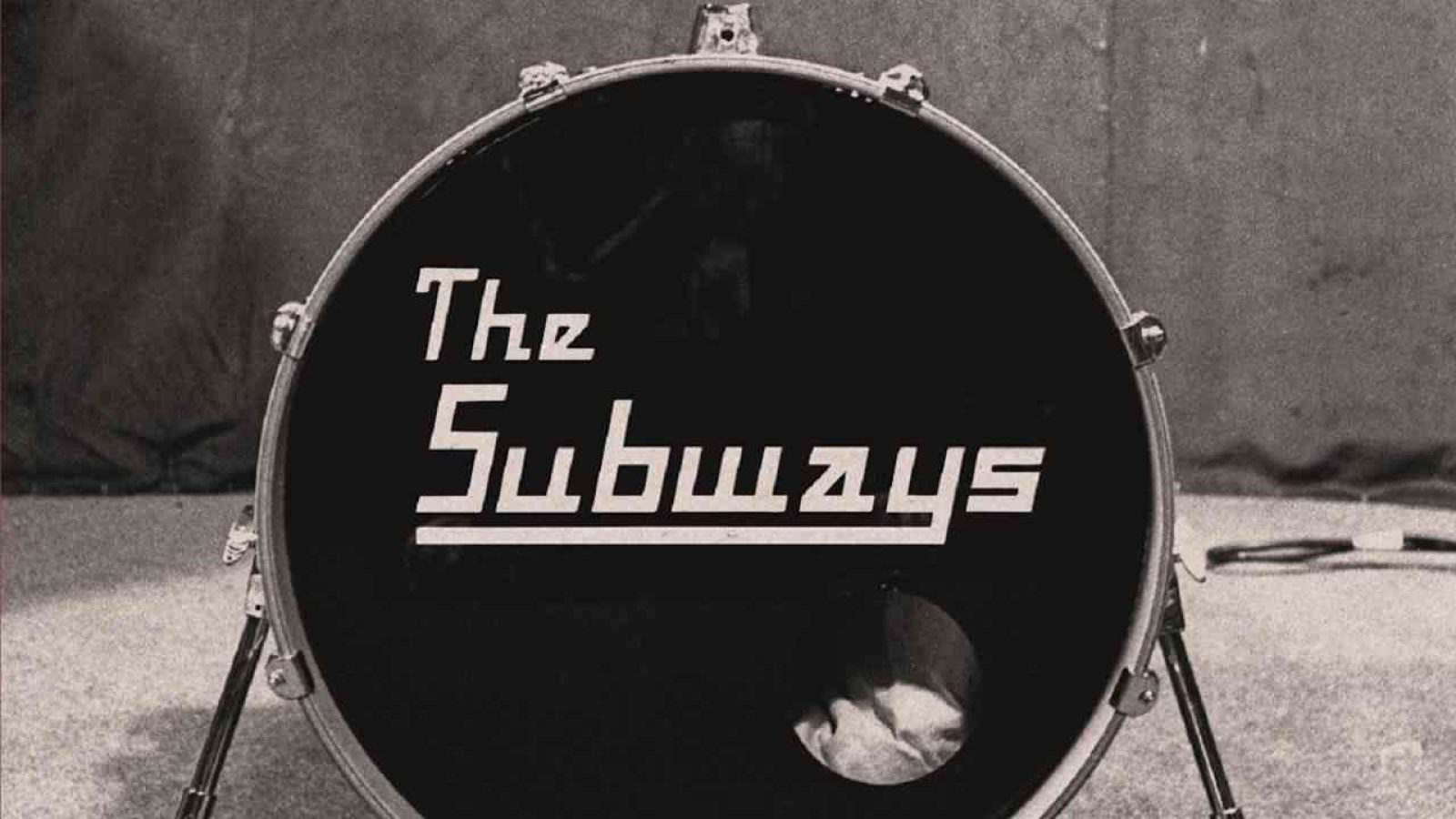INNSBRUCK. Der Neurobiologe Christian Humpel hat mit einer innovativen Methode neue Erkenntnisse zur Alzheimer-Krankheit gewonnen. Seine Forschungen an Mausgehirnschnitten liefern Belege für die sogenannte Spreading-Hypothese – also die These, dass krankhafte Eiweiße sich im Gehirn ausbreiten wie eine Lawine.
Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz. In über 99 Prozent der Fälle handelt es sich um eine altersbedingte, nicht-erbliche Erkrankung. Sie beginnt unbemerkt, oft Jahrzehnte vor dem Auftreten erster Symptome. Ursache ist das Absterben von Nervenzellen, das unter anderem durch die Ablagerung fehlgefalteter Eiweiße wie β-Amyloid und Tau-Protein ausgelöst wird. Diese Eiweiße verklumpen im Gehirn zu sogenannten Plaques – ein Prozess, der zunehmend die Hirnfunktion stört.
Im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekts nutzte Humpel eine ausgefeilte Labormethode: Organotypische Gehirnschnitte von Mäusen. Damit ließ sich beobachten, wie sich krankhaft veränderte Eiweiße von einem Schnitt zum anderen ausbreiten. Die Ergebnisse stützen die Spreading-Hypothese. „Wir können uns das wie eine Lawine vorstellen“, erklärt Humpel. Anfangs verlaufe die Ausbreitung langsam, später jedoch beschleunige sie sich rasant.
Humpels Methode ersetzt klassische Tierversuche: Die verwendeten Gehirnschnitte stammen von jungen Mäusen und erhalten durch spezielle Kultivierung die typische Zellstruktur. Dadurch lassen sich Prozesse wie die Wanderung von β-Amyloid, Tau oder auch α-Synuclein unter Laborbedingungen nachvollziehen. Letzteres ist vor allem in der Parkinsonforschung relevant.
Ein weiteres Ergebnis: Die Mikrogliazellen – das Immunsystem des Gehirns – reagieren auf die schadhaften Eiweiße. Sie versuchen, diese abzubauen. Doch im Alter lässt ihre Leistungsfähigkeit nach, was die Ausbreitung zusätzlich begünstigen könnte. Das erklärt möglicherweise auch, warum ein gesunder Lebensstil mit Bewegung, ausgewogener Ernährung und sozialer Aktivität als Schutzfaktor gilt.
„Die Gesellschaft altert, und mit ihr steigt die Zahl der Alzheimer-Erkrankungen. Wenn wir die Mechanismen besser verstehen, könnten wir früher eingreifen“, sagt Humpel. Er fordert mehr Grundlagenforschung, um mögliche Präventions- und Diagnoseverfahren weiterzuentwickeln. In einem Folgeprojekt sollen nun auch Gehirnschnitte von erwachsenen Mäusen oder verstorbenen Menschen untersucht werden.
Die Erkenntnisse könnten langfristig nicht nur Millionen Betroffenen helfen, sondern auch das Gesundheitssystem entlasten – auch in Regionen wie dem Emsland oder der Grafschaft Bentheim, wo immer mehr ältere Menschen leben und mit den Folgen von Demenzerkrankungen konfrontiert sind.