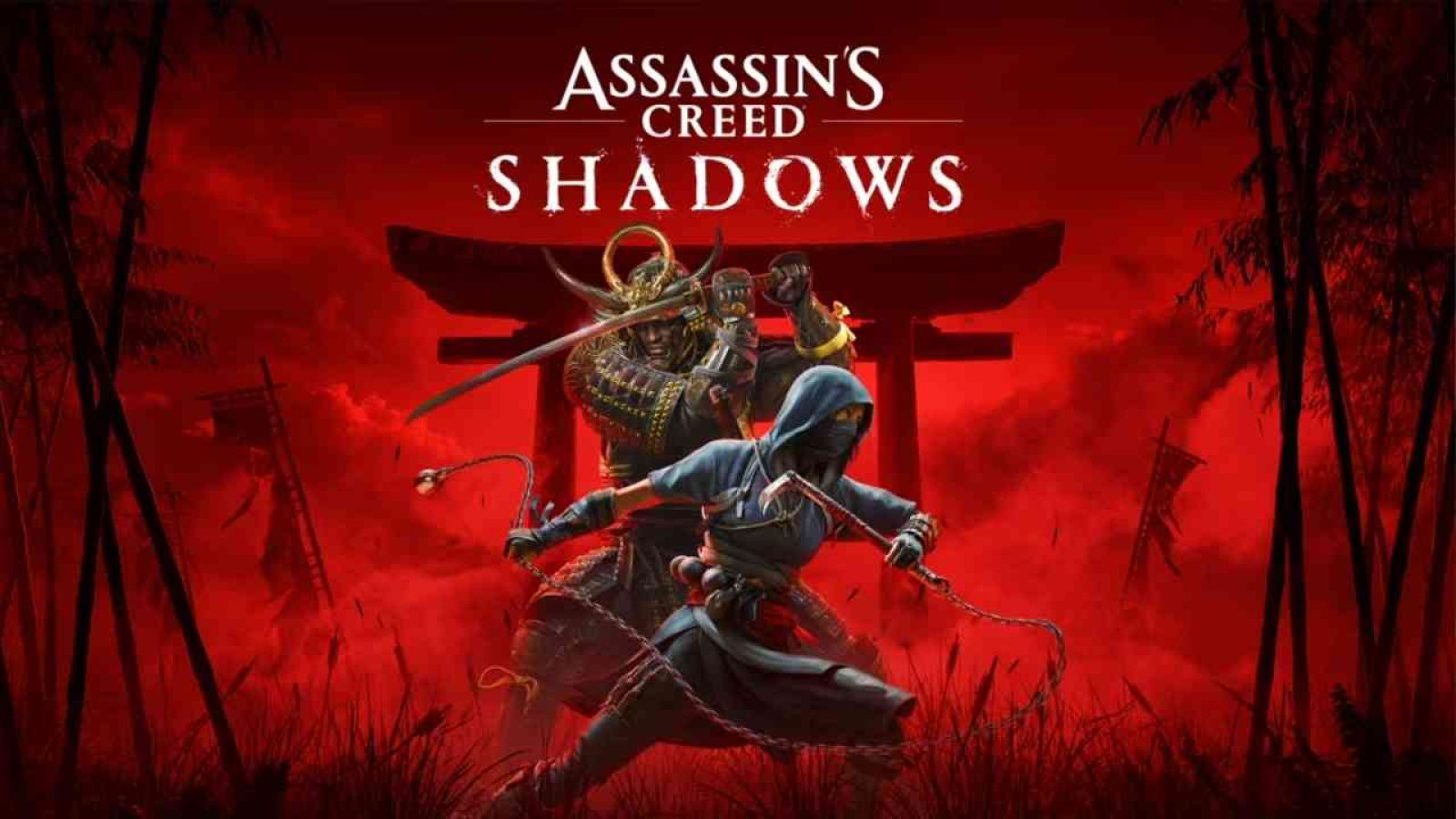Osnabrück. Wenn das Kind krank ist, stellt sich für viele Eltern die Frage: Kinderkrankentage nehmen oder alternative Lösungen finden? Ein neues Forschungsprojekt an der Universität Osnabrück untersucht, wie berufstätige Mütter und Väter mit dieser Herausforderung umgehen – und welche Rolle dabei Arbeitszeitmodelle, soziale Netzwerke oder betriebliche Strukturen spielen.
Wissenschaftliches Interesse an Lücken im Alltag
Das Projekt wird vom Niedersächsischen Wissenschaftsministerium und der VolkswagenStiftung mit rund 276.000 Euro gefördert. Es zielt darauf ab, eine Forschungslücke zu schließen: Zwar existiert ein gesetzlich verankerter Anspruch auf Kinderkrankentage für Eltern von Kindern unter 12 Jahren – doch wie oft dieser tatsächlich genutzt wird und wann Eltern auf andere Lösungen zurückgreifen, ist bislang kaum erforscht.
Prof. Dr. Katrin Golsch vom Institut für Sozialwissenschaften erklärt: „Wir wollen verstehen, welche Faktoren Eltern bei der Betreuung im Krankheitsfall beeinflussen. Homeoffice, flexible Arbeitszeiten oder Unterstützung durch Großeltern und Freundeskreis spielen dabei oft eine entscheidende Rolle.“
Auch Personalverantwortliche im Blick
Neben der Sicht der Eltern bezieht das Projekt auch Führungskräfte in Betrieben mit ein. Dr. Ayhan Adams, ebenfalls Projektleiter, betont: „Wir wollen untersuchen, wie Personalverantwortliche die Nutzung von Kinderkrankentagen oder informellen Vereinbarungen bewerten und wie betriebliche Rahmenbedingungen den Zugang zu Betreuungsoptionen beeinflussen.“
Im Fokus steht unter anderem die sogenannte „Dunkelziffer“: Eltern, die auf den offiziellen Anspruch verzichten, aber dennoch Arbeitszeit reduzieren oder informelle Absprachen treffen. Ziel der Forschenden ist es, in drei Jahren konkrete Empfehlungen für Politik und Unternehmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorzulegen.
Quelle: Universität Osnabrück