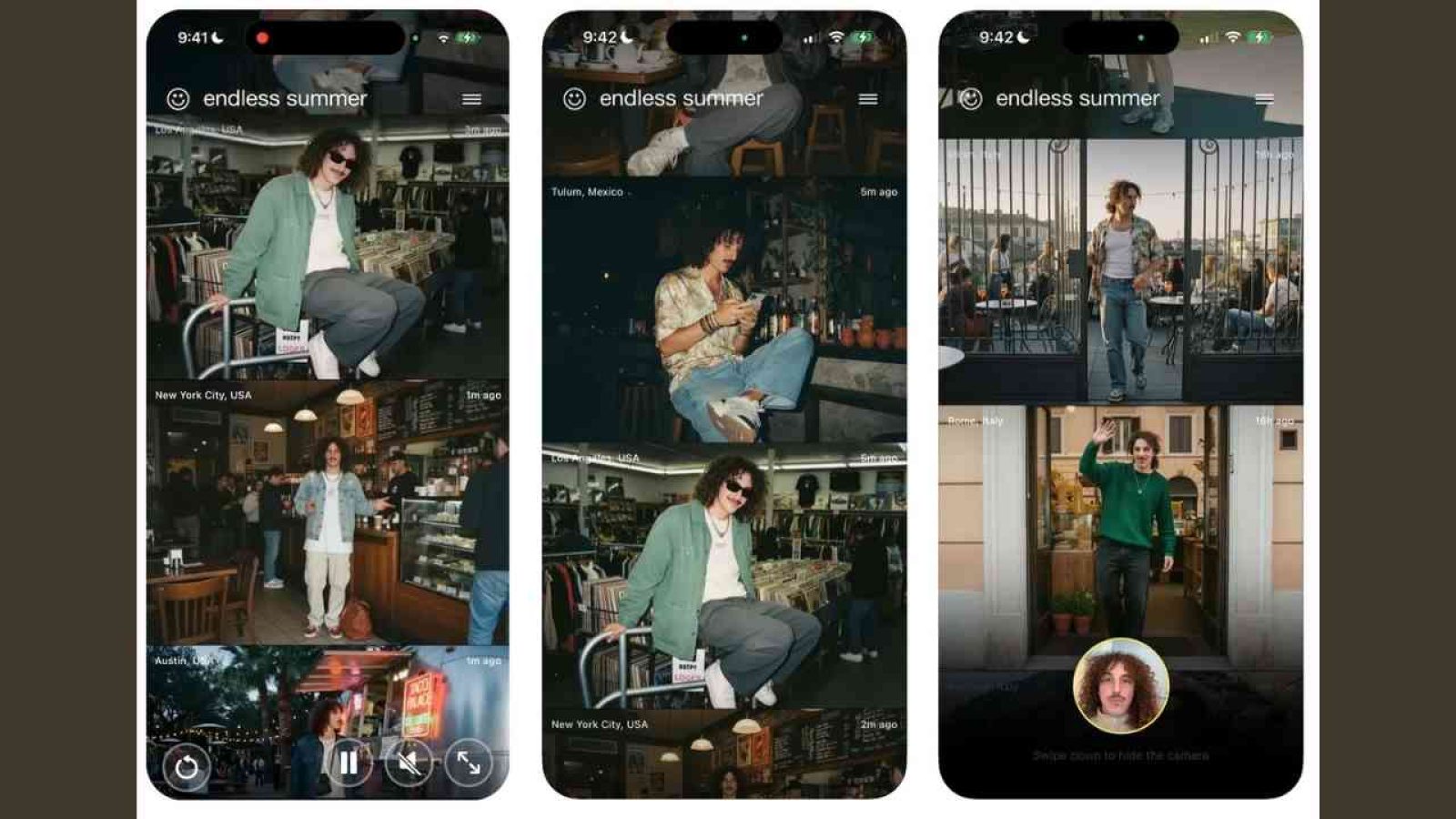Köln. Laut einer aktuellen Umfrage im ARD-DeutschlandTREND fühlt sich nur noch jeder zweite Deutsche im öffentlichen Raum sicher. Das Sicherheitsgefühl in Parks, auf Straßen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln ist rückläufig – mit teils deutlichen Unterschieden zwischen Geschlechtern und politischen Anhängerschaften.
Seit 2017 ist das persönliche Sicherheitsgefühl in Deutschland spürbar gesunken. Während sich damals noch drei Viertel der Befragten sicher fühlten, sind es heute nur noch 50 Prozent. Fast ebenso viele (48 Prozent) empfinden öffentliche Orte als eher oder sehr unsicher. Die repräsentative Befragung von infratest dimap im Auftrag der ARD wurde Anfang November unter 1.300 Wahlberechtigten durchgeführt. Besonders deutlich fällt der Unterschied zwischen Männern und Frauen auf: Während Männer sich mehrheitlich sicher fühlen (56 Prozent), äußern 53 Prozent der Frauen ein Unsicherheitsgefühl.
Sicherheit in der Öffentlichkeit rückläufig
Auffällig ist zudem die politische Dimension der Wahrnehmung: 79 Prozent der AfD-Anhänger fühlen sich eher oder sehr unsicher. Dagegen äußern sich Anhänger von Grünen (81 Prozent), Linken (72 Prozent) und SPD (64 Prozent) überwiegend sicher. Die Union liegt mit 53 Prozent eher sicheren Befragten im Mittelfeld.
Auch die Angst vor konkreten Bedrohungen im öffentlichen Raum ist weit verbreitet. Mehr als die Hälfte der Deutschen (52 Prozent) sorgt sich regelmäßig vor Diebstahl. Fast ebenso viele (48 Prozent) fürchten Anpöbelung oder Beleidigung. Ein Drittel hat Angst vor einem terroristischen Anschlag, und knapp jeder Dritte sorgt sich davor, körperlich verletzt zu werden. Besonders hoch ist unter Frauen (38 Prozent) die Sorge, sexuell bedrängt zu werden – bei Männern liegt dieser Wert bei lediglich 8 Prozent.
Wie sich das Sicherheitsgefühl weiterentwickelt, bleibt abzuwarten – eine politische Debatte ist bereits im Gange.
Die Ergebnisse der Umfrage spiegeln nicht nur gesellschaftliche Spannungen, sondern auch eine zunehmende Sensibilisierung für das Thema öffentliche Sicherheit wider. Wie Kommunen, Politik und Polizei darauf reagieren, dürfte in den kommenden Monaten die Diskussion prägen.