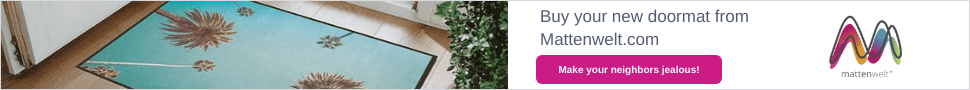Forschungsprojekt an der Universität Wien untersucht die Rolle von Dopamin bei sozialen Entscheidungen.
Wien. Warum vertrauen wir manchen Menschen mehr als anderen? Und wie beeinflusst unser Gehirn diese Einschätzung? Die Psychologin Dr. Bianca Schuster von der Universität Wien geht dieser Frage in einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt nach. Im Fokus steht der Neurotransmitter Dopamin – und seine Rolle bei der Interpretation sozialer Situationen.
Wenn Wahrscheinlichkeiten unser Verhalten steuern
Ob im Alltag oder beim Pokerspiel: Menschen treffen soziale Entscheidungen oft unter Unsicherheit. Laut Schuster basiert unser Verhalten dabei auf einem mathematischen Prinzip – der sogenannten Bayesschen Inferenz. „Wir wägen Vorwissen und neue Informationen gegeneinander ab, um soziale Signale zu interpretieren“, erklärt die Forscherin. Dopamin beeinflusse dabei, wie stark wir bestimmten Informationen vertrauen.
Künstliche Intelligenzen am Spieltisch
In einer eigens entwickelten Versuchsanordnung analysiert Schuster, wie Menschen Risiken einschätzen – etwa anhand eines simulierten Pokerspiels mit echten Mitspielern und KI-Gegnern. Entscheidend sei, wie viel Gewicht Teilnehmende ihren Vorerfahrungen beimessen und wie sich diese Einschätzung unter veränderten Dopaminwerten verändert. Eine Medikamentenstudie soll klären, ob sich Vertrauen durch Eingriffe in den Dopaminhaushalt messbar verschiebt.
Relevanz für psychische Erkrankungen
„Gerade bei Krankheiten wie Depression oder Schizophrenie beobachten wir oft Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen“, so Schuster. Ziel des Projekts ist es, die zugrunde liegenden neuronalen Mechanismen besser zu verstehen – und langfristig neue diagnostische oder therapeutische Ansätze zu entwickeln. Mithilfe computergestützter Modelle will das Team subtile Veränderungen in sozialen Einschätzungen sichtbar machen.
Perspektiven für Wissenschaft und Praxis
Das Forschungsprojekt wird im Rahmen des ESPRIT-Programms mit rund 300.000 Euro gefördert. Neben wissenschaftlichen Erkenntnissen könnte es künftig auch helfen, Krankheitsverläufe individuell besser zu verstehen oder die Wirkung von Medikamenten gezielter zu erfassen.